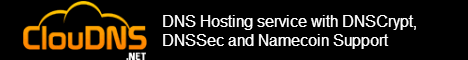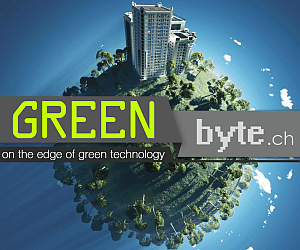IBM hat den erweiterten Bau des Rechenzentrums in Genf eröffnet. Das neue Gebäude umfasst 900 Quadratmeter. Die Anlagen erfüllen modernste Kriterien bei Sicherheit, Leistung und Energieeffizienz.

IBM-Vertreter eröffnen die Erweiterung des Rechenzentrums in Genf. Von Links: Sven Sachs, Guiseppe Cristofaro, Patrick Hendier, Edward Gaehwiler, Pascal Allot und Hanspeter Lengauer. (Elio Bonalume)
Am 17. Oktober hat IBM in Genf die Erweiterung des bestehenden Rechenzentrums in Betrieb genommen. Die total verfügbare Fläche steigt um 900 auf 3’100 Quadratmeter. Der neue Raum kann gemietet werden. Er wurde speziell gebaut für die Rechner der Kunden, so genannte «Co-Location». Das neue Zentrum ist vom existierenden Bereich technisch unabhängig und nach den modernsten Standards für Rechenzentren gebaut. Teile der Kühl-Technologien wurden in den IBM-Forschungslabors entwickelt. Das älteste Labor ausserhalb der USA steht seit den 1960er-Jahren in Rüschlikon.
Das Rechenzentrum in Genf dient den IBM-Kunden meistens als Notlösung für einen möglichen Ausfall der firmeninternen Anlage. Falls notwendig, können hier sogar vollständig ausgerüstete Arbeitsplätze belegt werden. Die Säle sind für Server in Racks konzipiert: Stromversorgung, Kühlung und Datenübertragungsleitungen sind bereits vorhanden. Die Anlagen verschiedener Kunden werden durch Zäune voneinander getrennt; elektronische und biometrische Systeme sichern den Zutritt. Für grössere Sicherheit kann die Zone sogar durch massive Wände und eigenständige Zugriffssysteme abgesichert werden. Zudem wird das Areal rund um die Uhr überwacht.
Grüne Lösung spart Diesel und Heizkosten
Sämtliche Ausrüstungen sind doppelt vorhanden. Die Stromversorgung wird nicht allein durch Diesel-Aggregate gesichert; rotierende unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme mit Schwungmasse erweitern die Leistung (Diesel- und CO2-frei). Die Kühlung des Gebäudes wird durch Kompressoren erzeugt: Bei mittleren oder tiefen Temperaturen teilweise oder sogar vollständig durch Wärmeaustausch mit der Aussenluft. Zusätzlich wird die erzeugte Warmluft für die Gebäudeheizung verwendet.
Zahlreiche Banken, internationale Organisationen, europäische Hauptsitze grosser Gesellschaften und industrielle Unternehmen, vorwiegend aus der Uhren- und Chemiebranche, sind in Genf und Umgebung ansässig. Alle diese Firmen stehen vor dem Problem, ein Haupt- und ein Notrechenzentrum zu betreiben, das modernsten Ansprüchen genügt. Dadurch verdoppelt sich auch der Energieverbrauch. Viele dieser Gesellschaften sollen es sich schlicht nicht leisten können, selber solche Anlagen zu bauen und zu betreiben. Dazu kommt noch der Wunsch (für Banken sogar eine Pflicht), dass Daten innerhalb der Landesgrenzen gespeichert bleiben. Der Markt am Genfersee ist dementsprechend gross und es ist keineswegs erstaunlich, dass in der Gegend neue Datenbunker aufgestellt werden.
Energieeffizienz von Rechenzentren
Rechenzentren sind riesige Energiefresser. Der einzelne Server verschlingt zwar heute viel weniger Strom als früher. Wegen der Miniaturisierung und der damit verbundenen Verdichtung in den Schränken nimmt jedoch der Stromverbrauch pro Volumeneinheit im Rechenzentrum ständig zu. Datenzentren, wie jenes von Google in Oregon, können gut 100‘000 Servereinheiten enthalten, meistens in Form von dicht übereinander gestapelten Blades. Man rechnet heute mit einem Stromverbrauch von 2 bis 5 Kilowatt pro Quadratmeter. Das ergibt mehrere Megawatt für das neue IBM-Modul in Genf.
Der Stromverbrauch der einzelnen Rechner- und Speichereinheiten für eine bestimmte Leistung oder Kapazität ist vorgeschrieben und lässt sich kaum reduzieren. Dazu kommt aber noch die für den Betrieb des Zentrums zusätzlich erforderliche Energie, hauptsächlich für die Kühlung. Rechenzentren werden zwar nicht mehr wie vor Jahren auf niedrige Temperaturen gekühlt, die Computer laufen heutzutage durschnittlich mit 25° Celsius. Dennoch verschlingt die Kühlung eines grossen Zentrums mehrere Megawatt. Durch die Architektur des Rechenzentrums wird versucht, die vorhandene Energie so gut wie möglich zu nutzen. Ökologische und ökonomische Interessen gehen Hand in Hand.
Nutzer und Erbauer sind meist nicht dieselben
Die Energieeffizienz eines Rechenzentrums beschreibt man durch den PUE-Faktor. Auch wenn dieser noch so hoch ist, kann ein Rechenzentrum ineffizient betrieben werden. Rechner, die nur teilweise belastet oder inaktiv sind, verbrauchen dennoch Energie und müssen gekühlt sein, ohne dass sie etwas leisten. Der Kampf um Energie-Effizienz endet nicht bei der Abgabe des Baus. Bei der Einweihung des Rechenzentrums in Genf betonte Jean-Michel Rodriguez, Spezialist bei IBM Frankreich, dass die Erbauer und Benutzer des Rechenzentrums nicht dieselben Leute sind und nicht dieselben Interessen haben.
(Jean-Luc Perrenoud, Genf)
Weitere Themen:
Neueste Artikel von Jean-Luc Perrenoud (alle ansehen)
- Was hat der Computer, das der Mensch nicht hat? - 7. Oktober 2014
- Nexenta forciert Umbruch im Speichermarkt - 6. Mai 2014
- X-Days 2014: Formelwechsel, bitte! - 28. März 2014