Eine Kampagne gegen das Bundesgericht um ein Stück Software spiegelt den revolutionären Wandel der Informatik, den Open Source und freie Software auslösen. Am Beispiel der preisgekrönten freien Software «Open Justitia» entzündet ein ehemaliger Zulieferer eine Diskussion um Steuergelder für Informatik. Sie ist absurd, von Unwahrheiten geleitet und kontraproduktiv.

Das Bundesgericht in Lausanne nutzt seit 30 Jahren eine eigene Informatikabteilung mit derzeit rund 21 Stellen. (pd)
Wenige Tage vor der Präsentation der Open Source Studie Schweiz von SwissICT und die Swiss Open Systems User Group CH Open sorgt freie Software für heisse Köpfe. In der Wintersession wird die SVP eine Interpellation einreichen. Sie fordert vom Bundesrat eine Aufklärung, ob das Bundesgericht berechtigt ist, auf dem Markt gerichtsfremde Dienstleistungen anzubieten. Am Montag lancierte die Gegenpartei einen Gegenangriff: Ebenfalls in der Wintersession will die Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit (mit 40 Mitgliedern von BDP, CVP, EVP, FDP, GLP, Grüne, SP, und SVP) eine Motion eingeben, um die Freigabe von Open-Source-Software durch öffentliche Institutionen explizit zu erlauben. Ist der Aufwand wirklich nötig? In Verfassung und Finanzhaushaltgesetz steht, dass der Staat nur dann gewerblich tätig sein darf, wenn es keine privaten Angebote gibt und ein Gesetz ihn dazu ermächtigt. Greenbyte.ch klärt die Hintergründe auf.
Stein des Anstosses ist freie Software
Die Version 1.0 der Eigenentwicklung des Schweizerischen Bundesgerichts ist seit 2007 im Betrieb. Als offene und freie Software «Open Justita» steht sie kantonalen Gerichten seit September 2011 gratis zur Verfügung. Weblaw, das ehemalige Software-Zulieferunternehmen des Bundesgerichts bekämpft seither gemeinsam mit Hilfe von verschiedenen Interessensvertretern in Medien, Parteien und Verbänden das Bundesgericht. Die Berner Firma tut dies, um die eigene, kostenpflichtige und geschlossene Software neben gewöhnlichem Marketing mit zusätzlichem öffentlichen Druck im Markt zu positionieren.
Weblaw hat sich seit einem Jahr zuerst beim Bundesgericht beschwert – ohne Erfolg. Daraufhin wurde das Berner Unternehmen über FDP-Ständerat Hans Hess bei der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Ständerats aktiv. Die Begründung war, dass sich das Bundesgericht als IT-Dienstleister betätigt und dafür aus Sicht von Weblaw keine gesetzliche Grundlage vorhanden sei. Auch dies blieb ohne Erfolg.
Bundesgericht als Opfer einer Kampagne
Weblaw gibt nicht auf und hat einigen Erfolg im Streuen von Unwahrheiten, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Um eine faire Berichterstattung zu gewährleisten, haben wir diesen Artikel Weblaw zur Stellungnahme vorgelegt. Doch auch die Recherchearbeit von Greenbyte.ch wurde mit der schriftlichen Stellungnahme und einem persönlichen Telefongespräch mit der Weblaw-Inhaberin Sarah Montani unbedarft mit falschen Daten zum Bundesgericht eingedeckt, um dieses schlecht aussehen zu lassen. Eine Resultat-Auswahl der politischen und medialen Kampagne präsentiert Weblaw auf der eigenen Website unter dem Titel «Ein kleiner Streifzug durch unsere Medien». Die Kampagne mit falschen Behauptungen über das Bundesgericht und deren Software könnte die Kantone bei ihrem Entscheid verunsichern, die Einführung verzögern und somit die Steuerausgaben erhöhen.
Ungedeckter Bedarf führt zu eigener Software
Das Schweizerische Bundesgericht hat die Software «Open Justita» vor mehreren Jahren für den Eigenbedarf entwickelt. «Die Programmierarbeit begann 2006, als Neuentwicklung der ersten eigenen Gerichtssoftware von 1991. Zuvor arbeitete das Gericht mit Schreibmaschine und Karteikarten», sagt Sabina Motta, Medien-Verantwortliche des Bundesgerichts, gegenüber Greenbyte.ch. Die Bundesrichter als letzte Instanz müssen sich vollständig auf die Gerichtssoftware verlassen können, die ihnen frühere Gerichtsentscheide sucht und anzeigt. Dies setzt einen Suchalgorithmus voraus. Dieser war damals, gemäss Bundesgericht, bei anderen Produkten auf dem Markt nicht vorhanden.
Die Informatik-Abteilung des Bundesgerichts besteht seit rund 30 Jahren. Seit 2011 wird mit 21,4 Stellen im Informatikbereich gearbeitet, zuvor waren noch rund 31 Stellen besetzt, bevor das Bundesverwaltungsgericht von der Bundesgerichtsinformatik getrennt wurde. Die Open-Source-Strategie des Bundesgerichts wurde laut Stellungnahme zum GPK-Entscheid im Jahre 2001 begonnen.
Bund und Kantone fördern freie Software
Im Sinne der Kantone und der E-Government-Strategie des Bundesrats stellte das Bundesgericht die Software am 1. September 2011 unter die freie Lizenz GPLv3. Gleichzeitig gründete das Bundesgericht eine offene Gemeinschaft, wie sie bei Open-Source-Projekten oftmals eingesetzt wird. Darüber koordiniert sich die Gemeinschaft aus Nutzer und Entwickler wie Kantone, Unternehmen und Universitäten. Laut Statuten sollen auf diese Art Kosten für die Informatik sinken, weil einmal mit Steuergeldern erstellte Software möglichst vielen öffentlichen wie auch privaten Nutzern zugute kommen. Als Plattform von Open Justitia dient Apache-Tomcat.
Beispiele für Kantonsgerichte mit Open Justitia sind Bern und Waadt. Der Kanton in der Romandie verfolgt wegen des Kostendrucks bereits eine umfassende Open-Source-Strategie für die Informatik-Beschaffung. Andere Länder wie Österreich haben eine einzige Lösung für alle Gerichte im Land. Dort hat das Justizministerium die Sache per Gesetz bestimmt. Auch die Schweiz hat solche, zentral koordinierten Staatslösungen mit dem Zivilstandsregister, das per Gesetz den Bund als zentrale Informations- und Informatikstelle mit einer einzigen Software für alle Kantone und Gemeinden verbindet. Braucht es für den Bund noch mehr Gesetze?
Die staatseigene Software mit Open-Source-Lizenz ermöglicht theoretisch sogar noch mehr Effizienz als beim Zivilstandsregister. Beispielsweise wegen des Suchalgorithmus für Gerichtsdokumente und dem automatisierten Metadaten-Index soll sich die Software auch für ähnliche Anwendungen wie beispielsweise für Dokumentmanagement für Unternehmen eignen. Im Sommer dieses Jahres wurde das Bundesgericht für Open Justitia am internationalen «Enterprise & IT Architecture Excellence Award» mit dem «Special Recognition Award» prämiert und an den CH Open Source Awards mit einem ausserordentlichen Sonderpreis ausgezeichnet. Die Jury würdigte explizit die Weitsicht des Bundesgerichts, durch ihre Initiative dem Steuerzahler langfristig Kosten zu sparen.
Kantone und IT-Zulieferer profitieren

Weblaw-Inhaberin Sarah Montani und CEO Franz Kummer kämpfen gegen die IT-Strategie des ehemaligen Auftraggebers, dem Schweizerischen Bundesgericht. (pd)
Neben den steuerfinanzierten Software-Entwicklungen des Bundesgericht, die nun der Wirtschaft und Gesellschaft zu freien Verfügung stehen, gibt es ein konkurrierendes Software-Produkt vom Berner Unternehmen Weblaw. Die Berner haben in den letzten Jahren an verschiedene Kantone Software und Services offeriert. Sie wurden aber nun mit der freien Software und weiteren Dienstleistern der Open-Justitia-Gemeinschaft wie dem Aargauer Unternehmen Delta Logic konfrontiert, die ebenfalls bei den Kantonen offerieren. Weil die Kosten so erheblich auseinander liegen, evaluieren die Kantone neu. Das passt Weblaw nicht.
In einem SRF-Tagesschau-Beitrag vom 20. Oktober bezichtigt die Weblaw-Inhaberin Sarah Montani das Bundesgericht des illegalen Verhaltens und der Gefährdung von Arbeitsplätzen. Doch auch die offenbar gefährdeten Weblaw-Arbeitsplätze würden mit Steuergeldern finanziert. Der Generalsekretär des Bundesgerichts Paul Tschümperlin kontert im Tagesschau-Beitrag, dass derzeit Steuergeld gespart wird. Die Software hat das Bundesgericht bezahlt und stellt sie nun frei zum Nutzen und Weiterentwickeln. Wie Greenbyte.ch bei der Recherche von einer nicht genannt werdenden Person erfahren hat, sind bereits Erweiterungen von Kantonen fertig gestellt und fliessen zukünftig für alle in die Software ein – ebenso gratis und frei für andere Kantone, wie die Software heute ist.
Doch nur mit kostenfreier Software ist noch kein Gericht bedient. Die Kantone brauchen Integration und Wartung, beispielsweise nutzt das Bundesgericht die freie Software Open Office anstatt das kostenpflichtige, proprietäre Microsoft Office, das bei Kantonen noch eher verbreitet ist. Passende Erweiterungen müssen Kantone mit eigenen Informatikangestellten entweder selbst übernehmen oder eben Dienstleister dafür bezahlen.
GNU/Linux popularisiert Open Source
Dass Software-Firmen heutzutage nicht mehr allein ihre eigenen proprietären Lösungen durchzwängen können, zeigt sich am Beispiel Microsoft, die im Rahmen des eigenen Cloud-Angebot Azure auch Linux- anstatt Windows-Server anbieten. Weblaw könnte anstatt politische Kampagnen zu fahren, Open Justitia ins Angebot aufnehmen. «Wir haben uns die Software angeschaut, aber sind davon nicht überzeugt. Sie wirkte chaotisch», sagt Weblaw-Inhaberin Montani auf unsere Anfrage. Die Firma nutze aber GNU/Linux als Serverbetriebsystem und sei Open Source gegenüber sehr aufgeschlossen.
Der SVP- und Weblaw-Vorwurf einer illegalen Tätigkeit des Bundesgerichts wirkt völlig absurd. Die Open-Source-Lizenz von Open Justitia verunmöglicht eine kommerzielle Vermarktung der reinen Software. Open Source Software in der öffentlichen Verwaltung fördert aber die Investitionssicherheit von Steuergeld, weil bei proprietärer Software immer das Risiko besteht, dass von heute auf morgen der Betrieb, die Weiterentwicklung oder der Support eingestellt wird. Dies könnte bei Weblaw passieren, denn Montani verneint auf unsere Anfrage eine zukünftige Open-Source-Lizenz ihrer Produkte; sie fügte jedoch an, dass sie die Möglichkeit nicht komplett ausschliesse.
ICT Switzerland prangert zu hohe Budgets an

Medienschau für die spärliche Zeit der Bundesrichter, deren Arbeit wird mit einem Informatikbudget erleichtert, das dem Dachverband ICT Switzerland ein Dorn im Auge ist. (pd)
Wie steht der Dachverband ICT Switzerland zur Freigabe von Software durch öffentliche Institutionen? «Das zeigt, dass sie zu hohe Budgets haben», sagt der Präsident, IT-Unternehmer und FDP-Nationalrat Ruedi Noser gegenüber Greenbyte.ch. «Wenn staatseigene Institutionen schon mit Steuergeldern in einem geschützten Bereich so hohe Investitionen für Software-Entwicklung tätigen, dann sollen sie das Produkt in ein Spin-Off auslagern, das sich dann am freien Markt beweisen kann,» fordert Noser. Öffentliche Institutionen sollen gemäss Noser nicht selbst Software entwickeln und auf dem Markt anbieten – und das mit Steuergeldern finanzieren «Es ist eine Sauerei», so Noser.
Der Dachverband ICT Switzerland hat mit dieser Stellungnahme grundsätzlich recht, gibt damit aber ungerechtfertigt Weblaw Schützenhilfe. Eine Open-Source-Gemeinschaft entspricht dem geforderten Spin-Off von Noser. Der Dachverband attackiert mit der Haltung aber den Mitgliedsverband der Swiss Open Systems User Group CH Open, die den Open-Source-Award und die Parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit fördert.
Trends verändern Bundesinformatik
Braucht es also doch mehr Gesetze? Denn eigentlich könnte der Staat solche Diskussionen mit klaren Gesetzen verhindern. Ist die E-Government-Strategie also noch nicht griffig genug? «Das denke ich nicht», sagt Urs Paul Holenstein, Leiter Rechtsinformatik beim Bundesamt für Justiz. «Wichtig ist, dass der Staat sagt, was er macht, damit die Investitionssicherheit von privatwirtschaftlichen Betrieben weiter besteht», so Holenstein gegenüber Greenbyte.ch. Er sieht die Debatte in Missverständissen und verdrehten Argumentationen begründet, die exemplarisch seien als Zeichen des Wandels zu mehr Offenheit und zu mehr Effizienz in der Verwaltung, beispielsweise mit Open Source Software oder neu auch Open Data. «Viele wissen noch nicht, wie sie damit am Besten umgehen. Doch um diesen Wandel kommen wir nicht herum.»
(Marco Rohner)
Weitere Themen:
Neueste Artikel von Marco Rohner (alle ansehen)
- Bund beschafft freihändig 49 Mio. Franken Auftrag von Oracle - 24. November 2016
- Ubuntu und Kubuntu 16.04 LTS im Test - 21. Oktober 2016
- Labdoo.org gewinnt Lenovo Schweiz - 4. Juli 2016

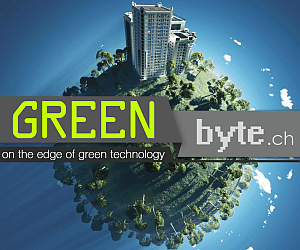




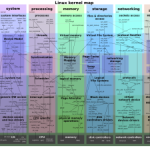






Hetzjagd gegen IT-Strategie des Bundesgerichts http://t.co/o4gkwsvg
Danke @greenbytech für hervorragenden Bericht zu OpenJustitia und Hetzjagd gegen OSS am Bundesgericht! http://t.co/4iyedZZb #parldigi @ppsde
RT @greenbytech: Hetzjagd gegen IT-Strategie des Bundesgerichts – http://t.co/gv2BDXJ9 #OSS #opensource #nachhaltigkeit
Immer dann wenn Steuergelder für Software ausgegeben werden, sollten Freie Alternativen evaluiert werden.
Wie sich an Open Justitia zeigt, ist oftmals auch eine Eigenentwicklung passender und kostengünstiger als ein kommerzielles Produkt. Solange diese Eigenentwicklungen wieder unter einer Freien Lizenz zur Verfügung gestellt werden, kann ich das nur begrüssen. Davon profitieren auch Gewerbetreibende sehr stark, die dann wiederum Dienstleistungen dazu anbieten können.
@wysseier Danke nachträglich für Kommentar zu OpenJustitia. Teile deine Meinung nicht. Lies http://t.co/ucyx2jso, da stehen die Hintergründe
Eine Schande, dass ein so zukunftsträchtiges Projekt http://t.co/03WqXjo5 derart torpediert wird: http://t.co/ZTNndQUF #openjustitia
@greenbytech super Artikel zum Thema #Openjustitia und die komischen Argumente von #Weblaw und #SVP http://t.co/XBVpesOj #parldigi
Was die ‘etablierten’ Online Medien nicht zu schreiben wagen: http://t.co/xEVGTd41 Ich bin für Subventionen für arme IT Unternehmen! :-P
Lesenswerter und präziser Kommentar zur Hetzjagd gegen die OpenSource Software Open Justitia des Bundesgerichts. http://t.co/hJeEXuKd
Differenzierter Hintergrundbericht zu Weblaw/SVP vs. Bundesgericht/OpenLaw: http://t.co/osjveKgY
/via @bglaettli
Amtssofties waren schon immer gute Informatiker http://t.co/DXZuV6MI via @phwampfler #openjustitia
Kanton Bern spart Steuergelder und SVP beklagt sich: @Weblaw lobbyiert wieder gegen OpenJustitia. Für @lenzchristoph: http://t.co/WW3lw0d8o4
Es ist falsch, dem #Steuerzahler vorzugaukeln, dass #OS-Vorhaben weniger kosten: SW-Entwicklung ist nicht gratis! http://t.co/uoaukyYFGF