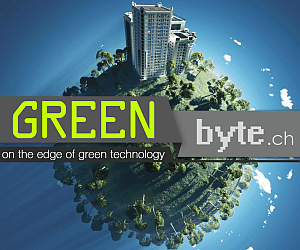«Wer teilt, gewinnt – was ist dran am Sharing-Boom?» hiess das Thema des diesjährigen Mediengesprächs der IBM in Ittingen bei Frauenfeld. In der inspirierenden Umgebung der Kartause referierten prominente Gäste aus der Schweiz und Deutschland über teilen, austauschen und kommunizieren in Forschung, Business und im alltäglichem Leben.
«Bei all diesen Kommunikationsmöglichkeiten wie Smartphones, Social Media riskiert man den Sinn für Priorisierung zu verlieren» meinte Christian Keller, Vorsitzender der Geschäftsleitung von IBM Schweiz, in seiner Einleitung zur Tagung. «Wichtig ist, Fokus zu behalten, Unwichtiges von Wichtigem zu trennen. Auf alle Fälle ist die IT der Enabler dieser Sharing-Economy.» Als einen Aspekt von Teilen nennt Christian Keller das «Sharen» von Inhalten, zum Beispiel über soziale Netzwerke (Social Media). In Marketing und Kommunikation wird unterschieden zwischen «Paid Media» (bezahlte Kommunikationskanäle wie Werbung), «Owned Media» (von Unternehmen betreut, wie Firmenzeitschriften oder -websites) und «Earned Media» (Inhalte, die Verbraucher ohne Auftrag eines Unternehmens selbst erstellen oder verbreiten). Getrieben durch die immense Verbreitung und Nutzung der «Social Media» teilen Konsumenten immer mehr Inhalte. Der Bereich «Earned Media» gewinnt dadurch für Unternehmen an Relevanz – sowohl für Marketing und Branding wie für eine direktere Kommunikation mit Kunden. Unternehmen können diese geteilten Informationen aber auch dafür nutzen, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen und ihre Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.
Teilen bei Innovationsprojekten
«Der Mythos des einsamen Genies obstruiert den freien Fluss des Wissens», argumentiert Karin Vey vom IBM Forschungszentrum Rüschlikon, zur Wichtigkeit des Teilens für den Erfolg von Innovationsprojekten. In Wissenschaft und Entwicklung ist das Teilen von Wissen, Ideen und Ressourcen entscheidender Treiber der Innovation. Dennoch besteht ein Spannungsfeld zwischen proprietärer Forschung und sogenannter «Open Innovation». Wer nicht kreativ ist, gerät schnell in eine existenzgefährdende Situation. Früher bedeutete Wissen Macht, seit der Informationsrevolution aber ist es eine Ressource, die man teilt. Offene Zusammenarbeit wirkt als Kenntnis-Generator.
Offene Innovation ist aber nicht in allen Fällen möglich oder ideal. Die Entscheidung hängt von der Geschwindigkeit des Wandels in der Branche und von der Strategie und Kultur der Firma ab. Sie ist vorwiegend geeignet für Firmen, die neue Möglichkeiten suchen und auch bereit sind, Risiken zu tragen. Die IBM hat in 2003 einen totalen Kulturwandel erlebt. Sie präsentiert sich heute offen und setzt sehr stark auf Kollaboration mit Schulen, anderen Firmen und öffentlichen Diensten. Dadurch wird Innovation getrieben, die sowohl dem Unternehmen wie der Gesellschaft dient. In Rüschlikon laufen zurzeit etwa 90 Kollaborationsprojekte.
Die Suche nach einem Partner für ein Innovationsprojekt gleicht der Erstellung einer Heiratsanzeige: man muss sich gut darstellen, eine Vision vom idealen Partner besitzen und wissen wo man hingehen will (und wo nicht), obwohl der gemeinsame Weg noch unklar ist. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit bedingt eine gemeinsame Vision und den gegenseitigen Wille, das Ziel zu erreichen. Absolut erforderlich ist ein «Leader», der totale Übersicht hat und das Projekt leitet. Ebenfalls muss das Problem des geistigen Eigentums vorab geklärt sein: wer hat was zugesteuert, wer kann was nutzen? Jedes Projekt ist anders.
Cyber-Kommunismus
«Teilen und Nutzen werden wieder zur Norm, Kaufen und Besitzen zur Ausnahme. Der Besitz als Behinderung gesehen». So der Schluss einer Untersuchung des Gottlieb Duttweiler Instituts (GDI) und des Referats «Sharity (sic!), die Zukunft des Teilens» von Karin Frick, Leiterin Research und Mitglied der Geschäftsleitung dieses Instituts. Bereitschaft zum Teilen war das Thema einer Umfrage, die das GDI in der Schweiz und Deutschland durchgeführt hat. Zusammengefasst: Wer teilt was, wie oft, wie gerne, mit wem, weshalb? Glaubt man den Resultaten (entsprechen aber Antworten zu einer Umfrage wirklich dem effektiven Verhalten?), befinden wir uns auf raschem Kurs in ein neues Zeitalter, in dem besitzen «out» ist (Adieu, eigenes Haus, Auto, Boot) und teilen, (pardon: «sharen»), «poolen», «exchangen» Norm wird. Gefördert und unterstützt durch die sozialen Medien, eine neue Generation von «on-line Communities» und «Websites», die erlauben alles Mögliche zu teilen: Autos, Wohnungen, und so weiter. Das Ziel dieser «Sites» ist natürlich der kommerzielle Erfolg, also geht’s hier schlussendlich trotzdem um Gewinn und Besitz. Sogar mit Teilen lässt sich Geld machen, mit Nächstenliebe oder Nachhaltigkeit hat das alles sehr wenig zu tun. Wen kümmert es, dass dabei ein paar weitere kalifornische «Entrepreneurs» zu Milliardären werden? Ihren Reichtum werden sie sicher nicht «sharen»! Das ist auch «OK», denn die Studie zeigt klar, dass Beträge über 1000 Franken eben nicht zu den Dingen gehören, die Leute gerne teilen!
Teilen bei der Arbeit
Zurück auf Erde mit dem Beitrag von Gudela Grote, Professorin der ETH Zürich, über «Teilen in der Arbeitswelt». Erfolgreiche Beispiele von Teilen sind Wissensaustausch, Stellenteilung, «Desk-Sharing», Aufgabenverteilung, offene Innovation. Offensichtlich nicht funktioniert hat das Teilen bei Diebstahl von geistigem Eigentum, Entlassung nach Übergabe von «Know-how», Schweigen über Missstände oder unklarer Arbeitstrennung. Teilen kann Verlust von Macht, Verfügungsgewalt und Status bedeuten, aber auch Erweiterung der eigenen Handlungsmöglichkeiten. Vieles hängt von der beruflichen Identität der Person ab. Geht es ihr um das haben: Stelle, Arbeitsplatz, eigene Sekretärin, Status, Wissen? Oder um das sein: innovativ, flexibel, kompetent, hilfsbereit, wissbegierig, arbeitsmarktfähig?
Wir Menschen lassen uns in Typen mit unterschiedlichen Karriere-Orientierungen einreihen: Eigenverantwortliche (21 Prozent der abgefragten Personen in einer schweizerischen Untersuchung), alternativ Engagierte (mit Interessen ausserhalb der Arbeit, 16 Prozent), Aufstiegsorientierte (49 Prozent), Sicherheitsorientierte (14 Prozent). Für jeden dieser Typen sind Selbstbestimmung, Grenzüberschreitung, berufliche Weiterbildung, Teilen unterschiedlich wichtig. Teilen bedingt Vertrauen und Gegenseitigkeit und funktioniert am Besten, wenn der juristische Arbeitsvertrag durch einen psychologischen ergänzt wird, der sich auf gegenseitige Loyalität stützt (was laut Grote in der Schweiz gut funktioniert). Leute, die in sich selbst vertrauen haben, teilen leicht. Gerade die, die es am meisten bräuchten, wollen es aber nicht tun, weil sie Angst davor haben.
Zehn Gebote vom Social Business
«Zehn Thesen zum Thema: Warum wir zum Social Business werden müssen» präsentierte Stefan Pfeiffer, Marketing Lead für Social Business bei IBM Europa. Ein Social Business werden ist heute nicht nur für Startups und IT-Firmen wichtig, sondern auch für traditionelle Unternehmen, inklusive KMUs. Ein «Social Business» (Anm. d. Red: Nicht zu verwechseln mit dem etablierteren Begriff von «Social Business» oder «Social Entrepreneurship» für Unternehmen nach gesellschaftlichen Werten) nutzt die Kollaborationswerkzeuge der «Social Media» zu seinem Vorteil. Mitarbeiter, Partner und Kunden werden in den Innovationsprozess einbezogen. Eine in der Schweiz von IBM durchgeführte Studie zeigt, dass fast drei Viertel aller Unternehmen erwarten, schon nächstes Jahr mit diesen Mitteln effektiver intern und mit Partnern zu kommunizieren.
Fast drei Viertel aller Unternehmen erwarten, schon 2014 mit Social Media effektiver zu kommunizieren.
Unternehmen müssen die Arbeitsbedingungen schaffen um junge Mitarbeiter zu motivieren. Die kommunizieren heute über Facebook und Twitter, nicht per E-Mail. Die Leitung muss eine Vertrauenskultur fördern, die «Social Business Attitude» vorleben. Das funktioniert aber nicht mit den Hierarchie- und Kontrollmustern von gestern, das Internet ist eine Transparenz-Maschine. Die Mitarbeiter sollen aus ihren E-Mail-Silos mit dem darin gebunkertem Sicherheits- und Herrschaftswissen herausgeholt und von den Vorteilen des offenen Austauschs überzeugt werden. Die Technik liegt hier im Hintergrund. Es geht um «Change Management» (niemand hat Änderung gerne!) und das erfordert eine Agenda und Coaching. Aber wenn das einmal intern funktioniert, kann es auch mit den Kunden und Lieferanten praktiziert werden.
Der Proletarier Mäzen
Über eine ganz andere Art von teilen sprach Journalist und Künstler Johannes Gees, Mitgründer der Crowdfunding Plattform «wemakeit.ch». Über diese Website kann jeder mithelfen, kulturelle Projekte zu fördern. «Das Prinzip sollte eher Community Funding heissen» meint Gees. «Social Media spielt dabei eine wesentliche Rolle: 35 Prozent der Leute kommen zu uns über Facebook.» In anderthalb Jahren seit der Gründung von «wemakeit.ch» wurden 400 Projekte mit einer Totalsumme von 3 Millionen Franken gefördert. 180‘000 Leute haben dabei durchschnittlich 100 Franken geleistet.
(Jean-Luc Perrenoud)
Weitere Themen:
Neueste Artikel von Jean-Luc Perrenoud (alle ansehen)
- Was hat der Computer, das der Mensch nicht hat? - 7. Oktober 2014
- Nexenta forciert Umbruch im Speichermarkt - 6. Mai 2014
- X-Days 2014: Formelwechsel, bitte! - 28. März 2014